Wie „Stop Killing Games“ die Spiele vor dem Aus rettet
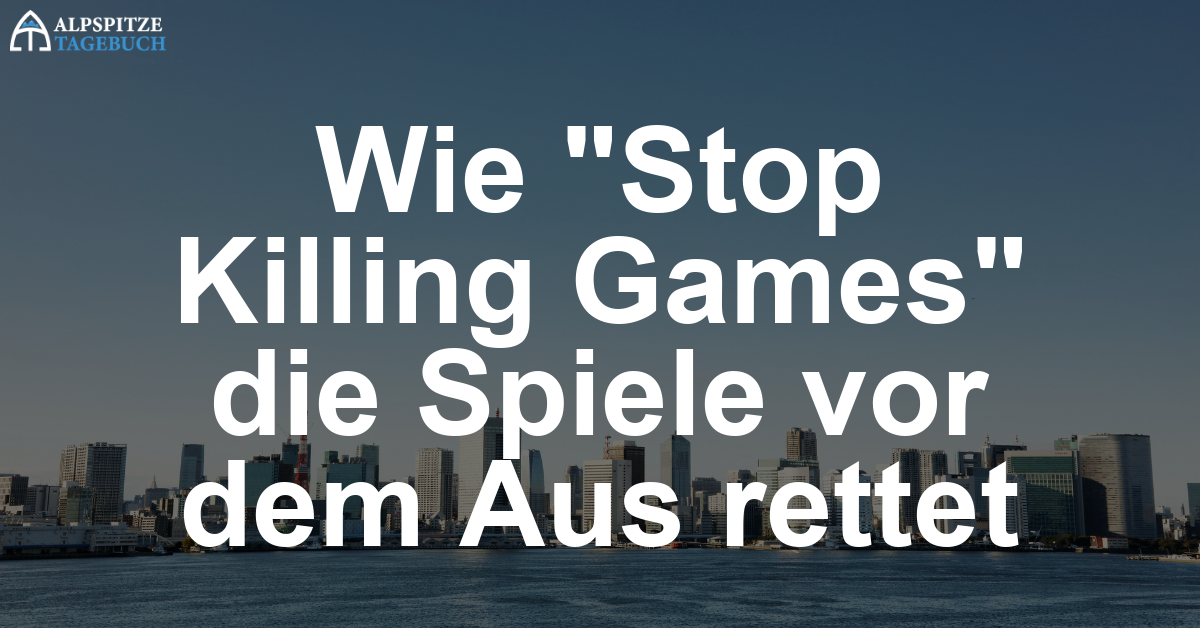
Die Initiative „Stop Killing Games“ hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt und die Gaming-Community mobilisiert. Mit dem erklärten Ziel, digitale Videospiele vor dem Vergessen zu bewahren, sobald Publisher ihre Server abschalten oder den Support einstellen, schien eine Welle der Veränderung in Gang gesetzt zu werden. Doch nach dem anfänglichen Hype und einer beeindruckenden Sammlung von Unterschriften stellt sich die Frage, ob es sich am Ende nicht doch um „viel Lärm um nichts“ handelt.
Die Vision hinter „Stop Killing Games“
Im Kern ist „Stop Killing Games“ eine Graswurzelbewegung, die sich für den Erhalt von Videospielen einsetzt, nachdem sie von den Publishern offline genommen werden. Auslöser war unter anderem die Abschaltung von Ubisofts Rennspiel „The Crew“ im Jahr 2024, das aufgrund seiner „Always-Online“-Natur danach unspielbar wurde. Die Bewegung zielt darauf ab, digitale Produkte, die als „gekauft“ beworben werden, auch nach dem Ende des Supports in einem funktionsfähigen Zustand zu belassen und die Abhängigkeit von Publisher-Servern zu beenden. Dies soll durch gesetzliche Änderungen auf EU-Ebene erreicht werden, wobei die Initiative eng mit dem vorgeschlagenen „Digital Fairness Act“ (DFA) verbunden ist.
Der Hype und die beeindruckende Beteiligung
Die Resonanz auf „Stop Killing Games“ war gewaltig. Die Europäische Bürgerinitiative „Stop Destroying Videogames“, die Teil der Bewegung ist, sammelte über 1,4 Millionen Unterschriften. Dieses Engagement markierte eine beispiellose Beteiligung an einer EU-Konsultation zum Thema Gaming. Die Kampagne wurde von namhaften YouTubern und Nachrichtenagenturen aufgegriffen und erhielt breite Unterstützung in der Community.
Ein wichtiger Erfolg war, dass die Initiative die erforderliche Schwelle von einer Million Unterschriften überschritt, was bedeutet, dass sie von der Europäischen Kommission geprüft werden muss. Selbst ein Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Nicolae Ștefănuță, sprach der Initiative seine Unterstützung aus.
Zwischen Erwartung und Realität: Wo die Initiative steht
Trotz der beeindruckenden Zahl an Unterschriften gibt es Hürden. Von den gesammelten 1,4 Millionen Signaturen mussten viele erst noch verifiziert werden. Zwar deuten erste Überprüfungen aus mehreren Ländern auf eine hohe Validierungsrate von etwa 97 % hin, was die Chance auf die benötigte Million gültiger Unterschriften stark erhöht. Jedoch fehlten zum Zeitpunkt der letzten Berichte noch die Verifizierungen aus Schlüsselmärkten wie Deutschland und Frankreich, die ihre Quoten noch nicht vollständig erreicht hatten.
Die Initiatoren zeigten sich dennoch zuversichtlich, die erforderlichen Schwellenwerte überschritten zu haben. Der Verifizierungsprozess wird voraussichtlich mehrere Monate dauern, danach wird die Petition an die Europäische Kommission übergeben, um die legislative Phase einzuleiten.
Der politische Effekt: Viel Lärm um wenig konkretes Ergebnis?
Bisher ist der konkrete politische Effekt der Kampagne noch begrenzt. Obwohl Gespräche mit EU-Abgeordneten und nationalen Regierungen stattfanden und die DFA-Konsultationsphase ein rekordverdächtiges Feedback erhielt, gibt es noch keine konkrete Gesetzesvorlage, keine verbindlichen Zusagen von Publishern oder eine klare legislative Reaktion aus Brüssel, die direkt aus der „Stop Killing Games“-Initiative resultiert.
Ein bemerkenswerter, wenn auch isolierter, Erfolg kann die Einführung eines „Hybrid-Offline-Modus“ für „The Crew 2“ durch Ubisoft sein. Dies ermöglicht es Spielern, ihren Online-Fortschritt in einen Offline-Speicherstand zu übertragen und das Spiel ohne ständige Internetverbindung zu spielen. Dieser Schritt wird weithin als Reaktion auf den Druck durch die „Stop Killing Games“-Bewegung interpretiert. Allerdings betrifft dies nicht das ursprüngliche „The Crew“, das weiterhin unspielbar bleibt, und ist auch kein umfassender politischer Durchbruch, sondern eine einzelne Reaktion eines Publishers.
Der Digital Fairness Act selbst, mit dem die Initiative verknüpft ist, befindet sich noch in der Konsultations- und Vorbereitungsphase. Ein legislativer Vorschlag wird frühestens in Q3-Q4 2026 erwartet. Während der DFA darauf abzielt, manipulatives Design, personalisierte Werbung und andere unethische Praktiken im digitalen Raum anzugehen, deckt er das Problem des dauerhaften Deaktivierens von Videospielen noch nicht explizit ab, obwohl die Initiative darauf drängt, dieses Thema in die Schutzmaßnahmen des DFA aufzunehmen.
Die Perspektive der Entwickler und die Grenzen des Protests
Viele Spieleentwickler, insbesondere in Europa, teilen die Frustration über geschlossene Server und Spiele, die unwiederbringlich verloren gehen. Sie kämpfen jedoch oft selbst mit wirtschaftlichem Druck, engen Zeitplänen („Crunch“) und Unsicherheiten. Für sie ist „Stop Killing Games“ ein wichtiges Anliegen, aber eines, das ihre unmittelbaren Arbeitsbedingungen nicht direkt beeinflusst.
Die Bewegung betont, dass sie nicht gegen die gesamte Branche kämpft, sondern gegen eine „Handvoll mächtiger Unternehmen“, die die Spieler und oft auch die Entwickler selbst unter Druck setzen. Die Organisatoren suchen den Dialog mit Studios und planen, Entwickler vor das Parlament zu bringen, um zu zeigen, wie Dinge anders sein könnten.
Fazit: Ein Weckruf mit offenem Ausgang
„Stop Killing Games“ hat zweifellos ein wichtiges Bewusstsein für die Problematik der digitalen Spieleerhaltung und der Konsumentenrechte im digitalen Raum geschaffen. Die beeindruckende Mobilisierung von über einer Million Unterschriften ist ein klares Signal an die Politik und die Spieleindustrie. Es zeigt, dass Spieler keine passiven Konsumenten mehr sind, sondern eine starke Stimme haben.
Dennoch ist der Weg von einer Petition zu einer konkreten politischen Reform lang und komplex. Der anfängliche Hype muss sich in nachhaltige legislative Arbeit übersetzen. Bisher handelt es sich eher um einen lauten Weckruf, der zwar auf Missstände hinweist und einzelne Reaktionen wie den Offline-Modus für „The Crew 2“ hervorruft, aber noch keine strukturellen Veränderungen bewirkt hat. Die Initiative steht vor der Herausforderung, den Druck aufrechtzuerhalten und die politischen Prozesse aktiv zu begleiten, um sicherzustellen, dass aus „viel Lärm“ tatsächlich eine dauerhafte „faire Behandlung“ für digitale Spiele wird.

