Marburg: Warum das Marburg-Virus so tödlich ist
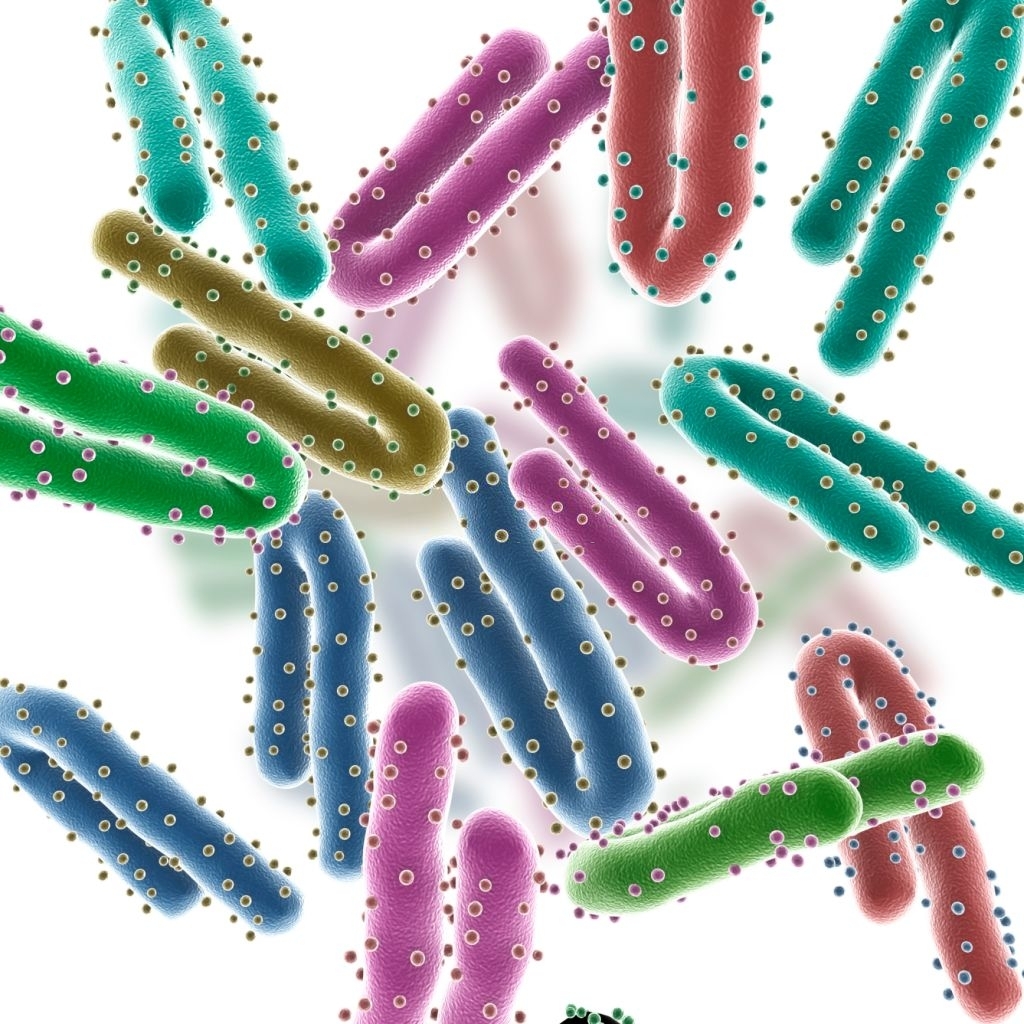
Das Marburg-Virus ist der Erreger der Marburg-Virus-Krankheit (MVD), einer Erkrankung mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 88%, die bei guter Patientenversorgung jedoch deutlich niedriger sein kann. Die Marburg-Virus-Krankheit wurde erstmals 1967 nach gleichzeitigen Ausbrüchen in Marburg und Frankfurt in Deutschland nachgewiesen; und in Belgrad, Serbien.
Marburg: Warum das Marburg-Virus so tödlich ist
Marburg- und Ebola-Viren gehören beide zur Familie der Filoviridae (Filovirus). Obwohl durch verschiedene Viren verursacht, sind die beiden Krankheiten klinisch ähnlich. Beide Krankheiten sind selten und können Ausbrüche mit hohen Todesraten verursachen.

Zwei große Ausbrüche, die 1967 gleichzeitig in Marburg und Frankfurt in Deutschland sowie in Belgrad, Serbien, auftraten, führten zur ersten Erkennung der Krankheit. Der Ausbruch war mit Laborarbeiten verbunden, bei denen aus Uganda importierte afrikanische Grüne Meerkatzen (Cercopithecus aethiops) verwendet wurden. In der Folge wurden Ausbrüche und sporadische Fälle in Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Südafrika (bei einer Person mit neuer Reisegeschichte nach Simbabwe) und Uganda gemeldet.
Übertragung
Anfänglich resultiert die MVD-Infektion beim Menschen aus einer längeren Exposition gegenüber Minen oder Höhlen, die von Rousettus-Fledermauskolonien bewohnt werden.
Marburg wird durch Mensch-zu-Mensch-Übertragung durch direkten Kontakt (durch verletzte Haut oder Schleimhäute) mit Blut, Sekreten, Organen oder anderen Körperflüssigkeiten von infizierten Personen sowie durch mit diesen Flüssigkeiten kontaminierte Oberflächen und Materialien (z. B. Bettwäsche, Kleidung) übertragen .
Bei der Behandlung von Patienten mit Verdacht auf oder bestätigter MVD wurden Mitarbeiter des Gesundheitswesens häufig infiziert. Dies geschah durch engen Kontakt mit Patienten, wenn die Vorsichtsmaßnahmen zur Infektionskontrolle nicht streng praktiziert wurden. Die Übertragung über kontaminierte Injektionsgeräte oder durch Nadelstichverletzungen ist mit einer schwereren Erkrankung, einer raschen Verschlechterung und möglicherweise einer höheren Sterblichkeitsrate verbunden.
Auch Bestattungszeremonien mit direktem Kontakt mit dem Leichnam des Verstorbenen können zur Überlieferung von Marburg beitragen.
Symptome der Marburg-Virus-Krankheit
Die Inkubationszeit (Intervall von der Infektion bis zum Auftreten der Symptome) variiert zwischen 2 und 21 Tagen.
Eine Erkrankung durch das Marburg-Virus beginnt abrupt mit hohem Fieber, starken Kopfschmerzen und starkem Unwohlsein. Muskelschmerzen und -schmerzen sind ein gemeinsames Merkmal. Schwerer wässriger Durchfall, Bauchschmerzen und -krämpfe, Übelkeit und Erbrechen können am dritten Tag beginnen. Durchfall kann eine Woche lang anhalten. Das Erscheinungsbild der Patienten in dieser Phase wurde als „geisterhafte“ gezeichnete Züge, tiefliegende Augen, ausdruckslose Gesichter und extreme Lethargie beschrieben. Beim Ausbruch in Europa von 1967 war ein nicht juckender Hautausschlag ein Merkmal, das bei den meisten Patienten zwischen 2 und 7 Tagen nach Einsetzen der Symptome festgestellt wurde.
Viele Patienten entwickeln zwischen 5 und 7 Tagen schwere hämorrhagische Manifestationen, und tödliche Fälle haben normalerweise eine Form von Blutung, oft aus mehreren Bereichen. Frisches Blut in Erbrochenem und Kot wird oft von Blutungen aus Nase, Zahnfleisch und Vagina begleitet. Spontane Blutungen an Venenpunktionsstellen (wo ein intravenöser Zugang erfolgt, um Flüssigkeiten zu verabreichen oder Blutproben zu entnehmen) können besonders störend sein. Während der schweren Krankheitsphase haben die Patienten hohes Fieber. Die Beteiligung des Zentralnervensystems kann zu Verwirrung, Reizbarkeit und Aggression führen. In der Spätphase der Erkrankung (15 Tage) wurde gelegentlich über Orchitis (Entzündung eines oder beider Hoden) berichtet.
In tödlichen Fällen tritt der Tod am häufigsten zwischen 8 und 9 Tagen nach dem Einsetzen der Symptome ein, in der Regel gehen schwerer Blutverlust und Schock voraus.
Diagnose
Es kann schwierig sein, MVD klinisch von anderen Infektionskrankheiten wie Malaria, Typhus, Shigellose, Meningitis und anderen viralen hämorrhagischen Fiebern zu unterscheiden. Der Nachweis, dass die Symptome durch eine Marburg-Virus-Infektion verursacht werden, erfolgt mit folgenden diagnostischen Methoden:
- Antikörper-Einfang-Enzym-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
- Antigen-Einfang-Nachweistests
- Serumneutralisationstest
- Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)-Assay
- Elektronenmikroskopie
- Virusisolierung durch Zellkultur.
Von Patienten entnommene Proben stellen ein extremes Biohazard-Risiko dar; Labortests an nicht inaktivierten Proben sollten unter maximalen biologischen Eindämmungsbedingungen durchgeführt werden. Alle biologischen Proben sollten beim nationalen und internationalen Transport mit dem Dreifachverpackungssystem verpackt werden.
Behandlung und Impfstoffe
Derzeit sind keine Impfstoffe oder geeignete Behandlungen für MVD zugelassen. Unterstützende Pflege – Rehydration mit oralen oder intravenösen Flüssigkeiten – und Behandlung spezifischer Symptome verbessern jedoch das Überleben und den Zustand des Patienten.
Es befinden sich monoklonale Antikörper (mAbs) in der Entwicklung und antivirale Mittel, z.B. Remdesivir und Favipiravir, die in klinischen Studien zur Ebola-Virus-Krankheit (EVD) verwendet wurden, die auch auf MVD getestet oder im Rahmen von Compassionate Use/erweitertem Zugang verwendet werden könnten.
Im Mai 2020 hat die EMA Zabdeno (Ad26.ZEBOV) und Mvabea (MVA-BN-Filo) eine Marktzulassung erteilt. gegen EVD. Das Mvabea enthält ein Virus namens Vaccinia Ankara Bavarian Nordic (MVA), das so modifiziert wurde, dass es 4 Proteine des Zaire-Ebolavirus und drei andere Viren derselben Gruppe (Filoviridae) produziert. Der Impfstoff könnte möglicherweise vor MVD schützen, seine Wirksamkeit wurde jedoch in klinischen Studien nicht nachgewiesen.
Marburg-Virus bei Tieren
Rousettus aegyptiacus Fledermäuse gelten als natürliche Wirte für das Marburg-Virus. Es gibt keine offensichtliche Krankheit bei den Flughunden. Infolgedessen kann sich die geografische Verbreitung des Marburg-Virus mit dem Verbreitungsgebiet der Rousettus-Fledermäuse überschneiden.
Aus Uganda importierte Afrikanische Grüne Meerkatzen (Cercopithecus aethiops) waren während des ersten Marburger Ausbruchs die Infektionsquelle für den Menschen.
Experimentelle Impfungen bei Schweinen mit verschiedenen Ebola-Viren wurden berichtet und zeigen, dass Schweine anfällig für eine Filovirus-Infektion sind und das Virus ausscheiden. Daher sollten Schweine als potenzieller Verstärkerwirt bei MVD-Ausbrüchen in Betracht gezogen werden. Obwohl für andere Haustiere noch keine Assoziation mit Filovirus-Ausbrüchen bestätigt wurde, sollten sie vorsorglich bis zum Beweis des Gegenteils als potenzielle Wirtsverstärker in Betracht gezogen werden.
In Schweinefarmen in Afrika sind Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, um eine Infektion von Schweinen durch Kontakt mit Flughunden zu vermeiden. Eine solche Infektion könnte das Virus möglicherweise verstärken und MVD-Ausbrüche verursachen oder dazu beitragen.
Prävention und Kontrolle
Eine gute Ausbruchskontrolle beruht auf einer Reihe von Interventionen, nämlich Fallmanagement, Überwachung und Kontaktverfolgung, einem guten Laborservice, sicheren Bestattungen sowie sozialer Mobilisierung und gemeinschaftlichem Engagement ist der wichtige Faktor bei der Bekämpfung von Ausbrüchen. Die Sensibilisierung für Risikofaktoren für eine Marburger Infektion und Schutzmaßnahmen, die der Einzelne ergreifen kann, ist ein wirksames Mittel, um die Übertragung auf den Menschen zu reduzieren.
Die Botschaften zur Risikominderung sollten sich auf mehrere Faktoren konzentrieren:
- Verringerung des Risikos der Übertragung von Fledermäusen auf den Menschen durch längere Exposition gegenüber Minen oder Höhlen, die von Flughundkolonien bewohnt werden. Bei Arbeits- oder Forschungstätigkeiten oder touristischen Besuchen in Minen oder Höhlen, die von Flughundkolonien bewohnt werden, sollten Menschen Handschuhe und andere geeignete Schutzkleidung (einschließlich Masken) tragen. Bei Ausbrüchen sollten alle tierischen Produkte (Blut und Fleisch) vor dem Verzehr gründlich gekocht werden.
- Verringerung des Risikos der Mensch-zu-Mensch-Übertragung in der Gemeinschaft durch direkten oder engen Kontakt mit infizierten Patienten, insbesondere mit deren Körperflüssigkeiten. Enger Körperkontakt mit Marburg-Patienten sollte vermieden werden. Bei der Pflege kranker Patienten zu Hause sollten Handschuhe und geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Regelmäßiges Händewaschen sollte nach dem Besuch kranker Angehöriger im Krankenhaus sowie nach der Pflege erkrankter Patienten zu Hause erfolgen.
- Von Marburg betroffene Gemeinden sollten sich um eine gute Information der Bevölkerung sowohl über die Art der Seuche selbst als auch über notwendige Maßnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs bemühen.
- Zu den Maßnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs gehören die schnelle, sichere und würdige Bestattung des Verstorbenen, die Identifizierung von Personen, die möglicherweise Kontakt mit einer mit Marburg infizierten Person hatten, und die Überwachung ihres Gesundheitszustands für 21 Tage, die Trennung von Gesunden von den Kranken, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, und die Versorgung von bestätigten Patienten und die Aufrechterhaltung einer guten Hygiene und einer sauberen Umgebung müssen beachtet werden.
- Verringerung des Risikos einer möglichen sexuellen Übertragung. Basierend auf weiteren Analysen der laufenden Forschung empfiehlt die WHO männlichen Überlebenden der Marburg-Virus-Krankheit 12 Monate lang ab dem Einsetzen der Symptome oder bis ihr Sperma zweimal negativ auf das Marburg-Virus getestet wurde, Safer Sex und Hygiene zu praktizieren. Der Kontakt mit Körperflüssigkeiten sollte vermieden werden und das Waschen mit Wasser und Seife wird empfohlen. Die WHO empfiehlt nicht, männliche oder weibliche Genesungspatienten zu isolieren, deren Blut negativ auf das Marburg-Virus getestet wurde.
Infektionskontrolle im Gesundheitswesen
Mitarbeiter des Gesundheitswesens sollten bei der Pflege von Patienten immer Standardvorkehrungen treffen, unabhängig von ihrer mutmaßlichen Diagnose. Dazu gehören grundlegende Händehygiene, Atemhygiene, die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (um Spritzer oder anderen Kontakt mit infizierten Materialien zu blockieren), sichere Injektionspraktiken und sichere und würdevolle Bestattungspraktiken.
Angehörige der Gesundheitsberufe, die Patienten mit Verdacht auf oder bestätigtem Marburg-Virus betreuen, sollten zusätzliche Maßnahmen zur Infektionskontrolle ergreifen, um den Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten des Patienten sowie kontaminierten Oberflächen oder Materialien wie Kleidung und Bettzeug zu verhindern. Bei engem Kontakt (innerhalb von 1 Meter) von Patienten mit MVD sollten medizinisches Personal einen Gesichtsschutz (einen Gesichtsschutz oder eine medizinische Maske und Schutzbrille), einen sauberen, unsterilen langärmeligen Kittel
Auch Labormitarbeiter sind gefährdet. Proben von Menschen und Tieren zur Untersuchung einer Marburg-Infektion sollten von geschultem Personal gehandhabt und in entsprechend ausgestatteten Labors verarbeitet werden.
Persistenz des Marburg-Virus bei Menschen, die sich von der Marburg-Virus-Krankheit erholen
Es ist bekannt, dass das Marburg-Virus bei einigen Menschen, die sich von der Marburg-Virus-Krankheit erholt haben, an immunprivilegierten Stellen persistiert. Zu diesen Stellen gehören die Hoden und das Innere des Auges.
- Bei Frauen, die sich während der Schwangerschaft infiziert haben, persistiert das Virus in der Plazenta, im Fruchtwasser und im Fötus.
- Bei Frauen, die sich während der Stillzeit infiziert haben, kann das Virus in der Muttermilch persistieren.
Eine rezidivsymptomatische Erkrankung ohne erneute Infektion bei jemandem, der sich von MVD erholt hat, ist ein seltenes Ereignis, wurde jedoch dokumentiert.
Die Übertragung des Marburg-Virus durch infiziertes Sperma ist bis zu sieben Wochen nach klinischer Genesung dokumentiert. Es sind mehr Überwachungsdaten und Forschung zu den Risiken der sexuellen Übertragung und insbesondere zur Prävalenz lebensfähiger und übertragbarer Viren im Sperma im Laufe der Zeit erforderlich. In der Zwischenzeit empfiehlt die WHO auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse Folgendes:
- Männliche Marburg-Überlebende sollten bei der Entlassung in ein Samentestprogramm aufgenommen werden (beginnend mit der Beratung) und innerhalb von drei Monaten nach Krankheitsbeginn Samentests angeboten werden, wenn sie geistig und körperlich dazu bereit sind. Samentests sollten angeboten werden, wenn zwei aufeinanderfolgende negative Testergebnisse vorliegen.
- Alle Marburg-Überlebenden und ihre Sexualpartner sollten eine Beratung erhalten, um sicherere Sexualpraktiken zu gewährleisten, bis ihr Sperma zweimal negativ auf das Marburg-Virus getestet wurde.
- Überlebende sollten mit Kondomen versorgt werden.
Marburger Überlebende und ihre Sexualpartner sollten entweder:
- sich aller sexuellen Praktiken enthalten oder
- durch korrekte und konsequente Verwendung von Kondomen sicherere Sexualpraktiken einhalten, bis ihr Sperma zweimal unentdeckt (negativ) auf das Marburg-Virus getestet wurde.
- Nach einem unentdeckten (negativ) Test können die Überlebenden ihre normalen Sexualpraktiken bei minimiertem Risiko einer Übertragung des Marburg-Virus sicher wieder aufnehmen.
- Männliche Überlebende der Marburg-Virus-Krankheit sollten 12 Monate lang ab dem Einsetzen der Symptome oder bis ihr Sperma zweimal unentdeckt (negativ) auf das Marburg-Virus getestet wurde, sicherere Sexualpraktiken und Hygiene praktizieren.
- Bis ihr Sperma zweimal unentdeckt (negativ) auf Marburg getestet wurde, sollten Überlebende nach jedem körperlichen Kontakt mit Sperma, auch nach der Selbstbefriedigung, eine gute Hand- und Körperhygiene praktizieren, indem sie sich sofort und gründlich mit Wasser und Seife waschen. Während dieser Zeit sollten benutzte Kondome sicher gehandhabt und sicher entsorgt werden, um den Kontakt mit Samenflüssigkeiten zu vermeiden.
- Allen Überlebenden, ihren Partnern und Familien sollte Respekt, Würde und Mitgefühl entgegengebracht werden.

